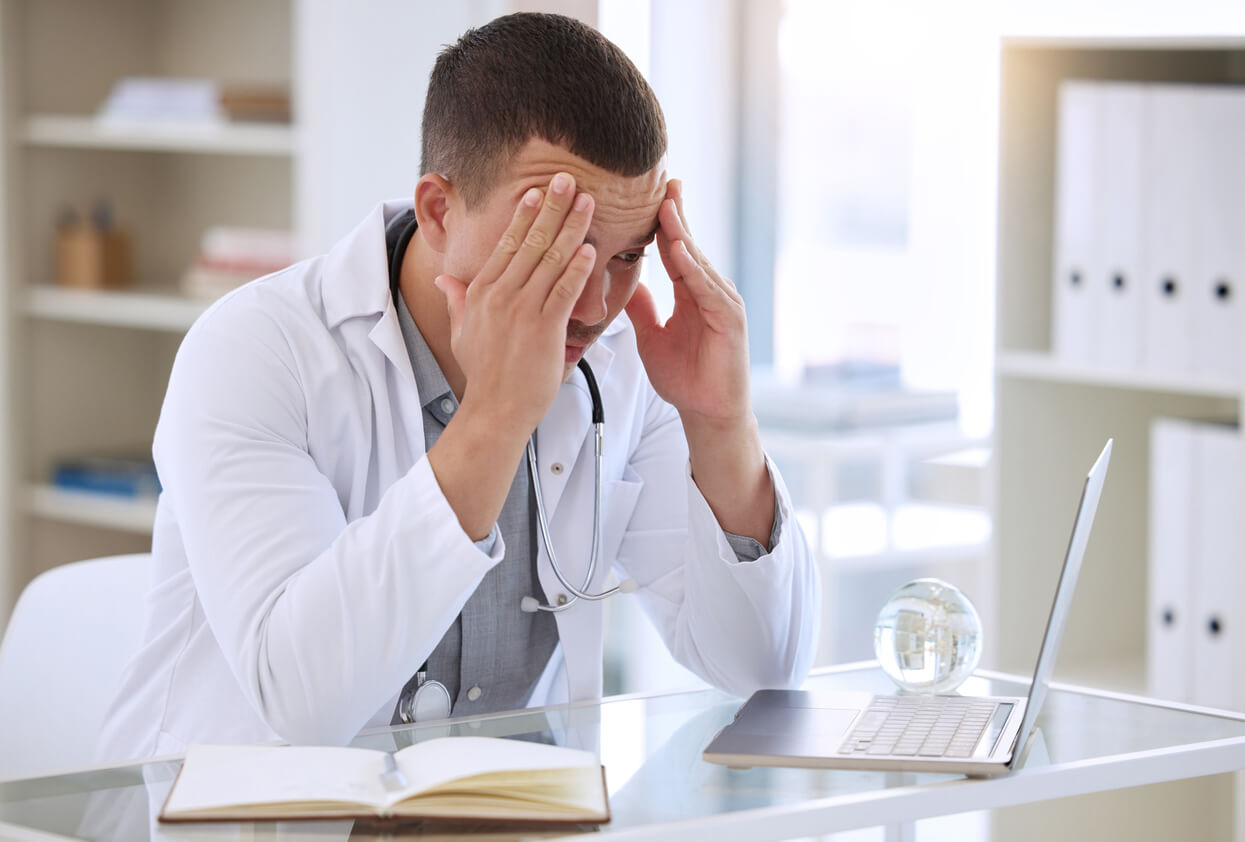Heilmittelverordnung – Auf einen Blick
- Definition: Eine Heilmittelverordnung ist ein ärztliches Rezept für Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Podologie oder Ernährungstherapie. Sie basiert auf der Heilmittel-Richtlinie des G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss).
- Voraussetzung: Vor der Ausstellung prüft der Arzt die Diagnose, dokumentiert den Befund und stellt sicher, dass keine gleichwertige und günstigere Behandlungsalternative besteht.
- Formular & Inhalt: Seit 2021 gilt ein einheitliches Formular (Muster 13), das Diagnose, Leitsymptomatik, Heilmittel, Häufigkeit und Dauer bündelt.
- Verordnungsrahmen: Der Heilmittelkatalog legt fest, welche Therapien für welche Diagnosen infrage kommen, inklusive Verordnungsmenge und orientierender Behandlungsdauer.
- Digitalisierung: Mit der elektronischen Verordnung (eVO) über die Telematikinfrastruktur werden ärztliche Anordnungen sicher digital übermittelt, wodurch Fehler reduziert und Abläufe zwischen Praxen, Therapeuten und Krankenkassen beschleunigt werden.
Definition: Was ist eine Heilmittelverordnung?
Eine Heilmittelverordnung ist die ärztliche Grundlage für Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie. Ärzte stellen sie aus, wenn eine Diagnose eine solche Behandlung erfordert und andere Maßnahmen nicht ausreichen.
Die Kosten übernehmen in der Regel die gesetzlichen Krankenkassen, sofern das Verordnungsformular korrekt ausgefüllt ist und den Vorgaben der Heilmittel-Richtlinie (§ 32 SGB V) entspricht.
Was sind Heilmittel?
Heilmittel sind ärztlich verordnete medizinische Leistungen, die von speziell ausgebildeten Therapeuten erbracht werden. Sie dienen dazu, Beschwerden zu lindern, Funktionen wiederherzustellen oder Einschränkungen im Alltag zu vermeiden.
Damit die Krankenkasse die Kosten übernimmt, ist eine gültige Verordnung eines Vertragsarztes notwendig, beispielsweise vom Hausarzt, Orthopäden oder Rheumatologen.
Zu den verordnungsfähigen Heilmitteln gehören unter anderem:
- Physiotherapie (z.B. manuelle Therapie, Bewegungstherapie, Wärme- oder Elektrotherapie)
- Ergotherapie
- Logopädie (Behandlung von Stimm-, Sprach-, Sprech- und Schluckstörungen)
- Podologie (medizinische Fußpflege)
- Ernährungstherapie
Mit der fortschreitenden Digitalisierung können diese Leistungen künftig (voraussichtlich ab 2027) auch im Rahmen einer elektronischen Verordnung (eVO) verordnet werden.
Verordnung von Heilmitteln & Heilmittelkatalog
Welche Heilmittel verordnet werden dürfen, legt der Heilmittelkatalog fest. Dieser ist Bestandteil der Heilmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) und definiert für jede Diagnose, welche Therapieformen infrage kommen.
Der Heilmittelkatalog enthält Angaben zu Indikationen, zugelassenen Heilmitteln, Behandlungsfrequenz und Verordnungsmenge.
Die Heilmittel-Richtlinie
Die Heilmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) bildet die verbindliche Grundlage für alle Heilmittelverordnungen. Sie legt fest, wann und in welchem Umfang Ärzte Heilmittel verordnen dürfen. Ziel ist es, die Versorgung klar zu strukturieren, Praxisabläufe zu vereinfachen und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Leistungen sicherzustellen.
Mit der zum 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Neufassung wurde das Verordnungsverfahren grundlegend überarbeitet. Die neue Verordnung wurde vom GKV-Spitzenverband zusammen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung vereinbart. Statt mehrerer Formulare gibt es seitdem ein einheitliches Muster 13 für alle Heilmittelbereiche.
Die neue Richtlinie entlastet Praxen durch eine übersichtlichere Struktur und den Wegfall des Genehmigungsverfahrens bei Verordnungen außerhalb des Regelfalls.
Auch die Möglichkeit der Blankoverordnung wurde eingeführt: Hierbei stellt der Arzt die Indikation, während der Heilmittelerbringer Dauer und Frequenz der Behandlung bestimmt.
Heilmittelbereiche im Überblick
Die Heilmittel-Richtlinie unterscheidet fünf zentrale Heilmittelbereiche. Jeder Bereich hat eigene Indikationen und Therapieformen, die je nach Diagnose ärztlich verordnet werden können.
- Ergotherapie: Ergotherapie unterstützt Menschen, deren Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist oder gefährdet sein könnte. Ziel ist es, Selbstständigkeit im Alltag, bei der Arbeit oder in der Freizeit zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Typische Maßnahmen sind motorisch-funktionelle Behandlungen, sensomotorisch-perzeptive Verfahren oder Hirnleistungstraining.
- Physiotherapie: Die Physiotherapie zählt zu den ältesten Heilverfahren und wird bei einer Vielzahl von Erkrankungen präventiv, therapeutisch und rehabilitativ eingesetzt. Dazu gehören Krankengymnastik, manuelle Therapie, Massagen, Thermotherapie (Wärme/Kälte) oder manuelle Lymphdrainage.
- Podologie: Die Podologie kommt bei bestimmten Fußschädigungen zum Einsatz, etwa beim diabetischen Fußsyndrom oder bei sensiblen Neuropathien. Ziel ist es, Folgeschäden zu verhindern und die Mobilität zu sichern.
- Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie: Diese Therapien umfassen Behandlungen zur Wiederherstellung oder Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit. Dazu zählen Stimmtherapie bei Problemen der Stimmbildung, Sprachtherapie bei neurologisch bedingten Ausfällen, Sprechtherapie bei Stottern sowie Schlucktherapie bei Dysphagien (Schluckstörungen).
- Ernährungstherapie: Ernährungstherapie wird nur in besonderen Fällen verordnet, z.B. bei seltenen angeborenen Stoffwechselstörungen wie Phenylketonurie oder bei Mukoviszidose. Sie gilt als medizinisch notwendig, wenn andere Maßnahmen nicht ausreichen.
Die Verordnungsmenge
Für jede Heilmitteltherapie ist im Heilmittelkatalog eine orientierende Behandlungsmenge hinterlegt. Damit soll sichergestellt werden, dass das angestrebte Therapieziel innerhalb einer festgelegten Anzahl von Einheiten erreicht werden kann. Ärzte orientieren sich bei der Verordnung also an klar definierten Richtwerten.
Ein Verordnungsfall bezieht sich immer auf den behandelnden Arzt. Das bedeutet: Stellt ein anderer Arzt eine Heilmittelverordnung aus, beginnt automatisch ein neuer Verordnungsfall. Maßgeblich ist dabei das Datum der letzten ausgestellten Verordnung. Liegt es länger als sechs Monate zurück, wird ebenfalls ein neuer Fall eröffnet. Liegt es darunter, wird der bestehende Fall fortgeführt. In medizinisch begründeten Situationen darf die orientierende Behandlungsmenge auch überschritten werden.
Die Abgrenzung über die Sechs-Monats-Frist schafft Klarheit für Praxen und Krankenkassen und reduziert Abstimmungsaufwand. Mit der elektronischen Verordnung (eVO) lassen sich Verordnungsfälle digital nachverfolgen, sodass Ärzte die relevanten Fristen direkt in ihrer Praxissoftware einsehen können.
Diagnoseliste
Die Heilmittel-Richtlinie sieht für bestimmte Erkrankungen eine vereinfachte Regelung vor. Grundlage sind die Diagnoselisten, die festlegen, wann von einem langfristigen Heilmittelbedarf auszugehen ist. Dadurch entfällt in vielen Fällen das aufwendige Genehmigungsverfahren durch die Krankenkasse.
Langfristiger Heilmittelbedarf (Anlage 2)
In Anlage 2 der Heilmittel-Richtlinie sind Diagnosen aufgeführt, bei denen automatisch ein langfristiger Heilmittelbedarf angenommen wird. Dazu zählen beispielsweise schwere neurologische oder rheumatologische Erkrankungen. Liegt eine solche Diagnose vor, können Ärzte Heilmittel verordnen, ohne dass die Verordnungen ins Budget einfließen oder ein gesonderter Antrag gestellt werden muss.
Voraussetzung ist die korrekte Angabe des ICD-10-Codes in Kombination mit der entsprechenden Diagnosegruppe aus dem Heilmittelkatalog. Damit wird die Verordnung als extrabudgetär gekennzeichnet und ist für Patienten langfristig abgesichert.
Dank elektronischer Verordnung (eVO) ist diese Kennzeichnung zukünftig digital möglich. Praxissoftware, die an die Telematikinfrastruktur angeschlossen ist, prüft automatisch die Zuordnung, wodurch sich Formfehler stark reduzieren lassen.
Langfristiger Heilmittelbedarf bei vergleichbaren Diagnosen (nicht in Anlage 2 gelistet)
Nicht alle Erkrankungen sind in der Anlage 2 aufgeführt. Wenn die Schwere oder Dauer einer Erkrankung jedoch vergleichbar ist, können Patienten einen individuellen Antrag bei der Krankenkasse stellen. Dafür reicht ein formloses Schreiben mit Kopie der Verordnung aus.
Wichtige Punkte dabei sind:
- Die Verordnung muss medizinisch begründet sein.
- Die Therapie darf während des laufenden Antrags begonnen werden.
- Reagiert die Krankenkasse nicht innerhalb von vier Wochen, gilt der Antrag automatisch als genehmigt.
- Eine Genehmigung umfasst mindestens ein Jahr und kann auch unbefristet erteilt werden.
Häufige Fragen und Antworten
Was ist eine Heilmittelverordnung?
Eine Heilmittelverordnung ist ein ärztliches Rezept für medizinische Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Podologie oder Ernährungstherapie. Sie basiert auf der Heilmittel-Richtlinie und gibt Diagnose, Therapieform, Frequenz und Dauer vor.
Seit 2021 erfolgt die Ausstellung über ein einheitliches Formular (Muster 13) – in Zukunft auch als elektronische Verordnung (eVO) über die Telematikinfrastruktur.
Wie lange ist ein Rezept für eine Heilmittelverordnung gültig?
Nach Ausstellung muss eine Heilmittelbehandlung innerhalb von 28 Kalendertagen begonnen werden. Erfolgt der Therapiebeginn später, verliert die Verordnung ihre Gültigkeit. Die Fortführung und mögliche Unterbrechungen richten sich nach den Vorgaben der Heilmittel-Richtlinie.
Wird eine Heilmittelverordnung von der Krankenkasse bezahlt?
Ja, die Kosten werden in der Regel von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen, sofern die Verordnung den Vorgaben der Heilmittel-Richtlinie entspricht. Versicherte leisten lediglich die gesetzliche Zuzahlung (10 Euro pro Verordnung plus 10 Prozent der Heilmittelkosten), es sei denn, sie sind von Zuzahlungen befreit. Über die eVO können Krankenkassen die Verordnungen schneller prüfen, sodass die Kostenübernahme effizienter abgewickelt wird.
Häufige Fragen und Antworten
Telematikinfrastruktur?




.svg)